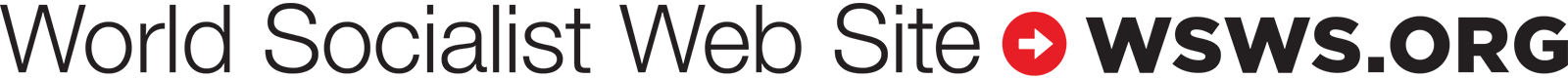Den folgenden Vortrag hielt David North, Chefredakteur der World Socialist Website und Vorsitzender der Socialist Equality Party in den USA, am 27. September im Rahmen des 49. Deutschen Historikertags in Mainz. North sprach in deutscher Sprache. Zweiter Redner war Prof. Mario Kessler, Dozent und Forscher am Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZZF) in Potsdam.
Zu der Veranstaltung in Mainz hatte der Mehring Verlag eingeladen, der dort auch die zweite, stark erweiterte Auflage von Norths Buch „Verteidigung Leo Trotzkis“ vorstellte. North setzt sich darin mit den Trotzki-Biografien der britischen Historiker Robert Service, Ian Thatcher und Geoffrey Swain auseinander, weist ihnen eine Vielzahl von Verdrehungen, Verleumdungen und Fälschungen nach und entwirft dabei ein lebendiges Bild des Lebens und Werks Leo Trotzkis.
Gern nehme ich die Gelegenheit wahr, am Historikertag an der Universität Mainz teilnehmen zu dürfen. Besonders freut es mich, das Podium heute Abend mit Professor Mario Kessler zu teilen. Als Wissenschaftler von internationalem Format sind ihm Kontroversen über historische Themen nicht fremd. Er hat viel dazu beigetragen, die politische Pathologie des Antisemitismus auszuleuchten und die komplexe Beziehung zwischen der Entwicklung der sozialistischen Arbeiterbewegung und dem jüdischen Volk darzulegen. Mit diesem Interessenschwerpunkt weiß Professor Kessler bei jeder Publikation von vornherein, dass er irgendjemandem auf die Zehen treten wird – bisweilen sogar seinen Freunden. Das kann ich ihm aus eigener Erfahrung nachfühlen.
Danken möchte ich auch meinen Genossen vom Mehring Verlag, insbesondere Wolfgang Weber, für ihre umfangreichen Bemühungen, mein Buch „Verteidigung Leo Trotzkis“ einem breiten Publikum in Deutschland zur Kenntnis zu bringen. Dieses Buch ist soeben in einer zweiten Auflage erschienen. Für mich ist das eine neue Erfahrung. Über viele Jahrzehnte hinweg hatte ich mich in der sozialistischen Bewegung daran gewöhnt, dass es durchaus ein paar Jahre dauern kann, bis die Zahl der Leser meiner Bücher und Broschüren die Höhe der Erstauflage erreicht. Bei „Verteidigung Leo Trotzkis“, insbesondere der deutschen Ausgabe, musste ich nicht so lange warten.
„Habent sua fata libelli“, lautet ein bekanntes Sprichwort: „Bücher haben ihr eigenes Schicksal.“ Wie ich kürzlich der unvergleichlichen Informationsquelle unserer Zeit, Wikipedia, entnehmen konnte, handelt es sich um eine verkürzte und vereinfachte Fassung einer tiefgründigeren Aussage, die dem antiken Grammatiker Terentianus Maurus zugeschrieben wird. Dieser schrieb: „Pro captu lectoris habent sua fata libelli“ (wörtlich: „Das Schicksal der Bücher hängt davon ab, was der Leser begreift“).(1) Mit anderen Worten, der Leser trägt aktiv zum Schicksal eines Buches bei. Nur durch seine Leser findet ein Buch Eingang in die Welt.
„Verteidigung Leo Trotzkis“ zog glücklicherweise die Aufmerksamkeit einer ganzen Reihe äußerst gewissenhafter Forscher auf sich. Professor Bertrand Patenaude verfasste eine Parallelbesprechung meines Buches und der Trotzki-Biografie von Robert Service, die im Juni 2011 in der American Historical Review erschien und große Beachtung fand. Dem folgte der Offene Brief an Suhrkamp, unterzeichnet von den Professoren Hermann Weber, Mario Kessler, Helmut Dahmer, Bernhard Bayerlein, Heiko Haumann, Wladislaw Hedeler, Andrea Hurton, Hartmut Mehringer, Oskar Negt, Hans Schafranek, Oliver Rathkolb, Peter Steinbach, Reiner Tosstorff und Rolf Wörsdörfer.
Zweifellos vertreten die Unterzeichner und ich oftmals ganz unterschiedliche Einschätzungen, was das Wesen der russischen Revolution, den Aufstand vom Oktober 1917 unter der Führung der Bolschewiki, den Charakter der Sowjetregierung und die politischen Auffassungen und die historische Rolle Trotzkis angeht. Auch untereinander dürften die Unterzeichner diese Entwicklungen durchaus verschieden bewerten. Wenn Professor Kessler eine Biografie Leo Trotzkis verfassen würde, dann würde sicherlich ein ganz anderes Werk entstehen, als wenn ich diesen Versuch unternähme. Wie könnte es anders sein? Unsere Arbeiten würden unsere unterschiedlichen Sichtweisen, Interessen und Erfahrungen widerspiegeln – kurz, dass wir verschiedene Menschen sind. Trotzdem würden wir beide von den tatsächlichen historischen Gegebenheiten ausgehen. Geschichtsforschung ist immer die Rekonstruktion eines objektiven Prozesses. Im Zuge der Interpretation soll der geschichtliche Verlauf nicht verzerrt, sondern geklärt werden.
Trotzki mag eine komplexe und widersprüchliche Figur gewesen sein, aber er war ein realer Teilnehmer an einem objektiven gesellschaftlichen und historischen Prozess. Sein Handeln und seine Ideen sind umfassend dokumentiert. Die einschlägigen Archive bergen dazu Unmengen an Material. Es stammt aus sehr zahlreichen und ganz verschiedenartigen Quellen. Kaum ein anderer Mann hat je derart gegensätzliche Reaktionen ausgelöst. Neben den Erinnerungen und Schilderungen seiner Anhänger finden wir die Verurteilungen jener, die ihn hassten. Trotzki war einer der produktivsten Autoren seiner Zeit. Nicht einmal das größte Archiv, das sich in der Houghton-Bibliothek in Harvard befindet, enthält eine vollständige Sammlung seiner Schriften. Ein erheblicher Teil dieser Schriften wurde noch nicht veröffentlicht. Trotzkis Ideen, die in seinen zahlreichen Büchern, Aufsätzen, Zeitungsartikeln und auch in Diskussionsprotokollen zum Ausdruck kommen, haben das politische und geistige Leben unzähliger Länder außerordentlich stark und nachhaltig beeinflusst.
Ein Historiker, der sich die riesenhafte Aufgabe stellt, die Biografie einer historischen Gestalt von der Größe Trotzkis zu verfassen, muss bereit sein, sich in die Archivunterlagen zu vertiefen. Er muss bereit sein, die notwendige Zeit aufzubringen, um die Figur und ihre Epoche zu verstehen – und diese Zeit bemisst sich nicht nach einigen Monaten, sondern nach Jahren.
Das Wesen seiner Arbeit erlegt dem Historiker die Pflicht auf, sich intensiv mit der Fülle an Aufzeichnungen über den objektiven Entwicklungsgang auseinanderzusetzen. Das ist der springende Punkt. Natürlich hat jeder Biograf einen „Standpunkt“. Doch sollte er sich nicht berufen fühlen, seine Figur mit Belehrungen, Strafpredigten und Vorwürfen zu überziehen, weil sie andere Ansichten vertrat als er und in anderen Zeiten lebte. Selbst ein britischer Tory (oder auch ein rechter Sozialdemokrat), der über einen russischen Kommunisten schreibt, sollte sich bemühen, den historischen und gesellschaftlichen Kontext zu erfassen, der das Denken seiner Figur prägte und ihr Handeln bestimmte. Natürlich hat ein Historiker eigene Ideen und muss sie auch haben. Sonst wären seine Werke niemals interessant. Dennoch muss er die Ideen seiner Figur durchdenken und ihnen eine gewisse Legitimität einräumen, und sei es nur durch die Berücksichtigung der historischen Umstände, die sie hervorbrachten. Um eine Formulierung des Historikers R. G. Collingwood zu verwenden, die von E. H. Carr überliefert wurde: „Der Historiker muss in Gedanken neu erschaffen, was in den Köpfen seiner handelnden Personen vorging.“ (2)
Es versteht sich von selbst, dass der Historiker außerdem im Umgang mit dem Archivmaterial und mit allem, das unter die breite Kategorie der gemeinhin so bezeichneten „Tatsachen“ fällt, eine unbeugsame Aufrichtigkeit an den Tag legen muss. Natürlich hat kein Historiker zu einem wichtigen Thema jemals „alles gelesen“, obwohl das gern behauptet wird. Er wird aber nach bestem Wissen und Gewissen bemüht sein, alles zu finden und zu prüfen, was für eine facettenreiche Nachbildung seines historischen Subjekts notwendig ist. Die Fakten dürfen nicht willkürlich oder parteilich herausgegriffen werden. Und sie müssen wahrheitsgetreu dargestellt werden. Nichts kann den Ruf eines Historikers und die Glaubwürdigkeit seines Werks so unwiederbringlich zerstören wie die Feststellung, dass er die Tatsachen falsch darstellt, dass die von ihm zitierten Dokumente seine Aussagen und Behauptungen nicht belegen oder dass er in der einen oder anderen Weise die historischen Dokumente falsch wiedergegeben hat, um einer vorgefassten Erzählung Genüge zu tun.
In den drei Jahren seit meiner ersten Analyse von Services Biografie ist unwiderlegbar nachgewiesen worden, dass sie allen Regeln der Geschichtswissenschaft Hohn spricht. Sein Buch ist, wie im Brief der 14 Historiker ganz richtig festgestellt wird, „eine Schmähschrift“. Obwohl ich meine Kritik in weiteren Vorträgen, darunter zwei in Berlin und einer in Leipzig, noch erheblich erweitert hatte, gelang es mir nicht, alle Fehler, Verdrehungen und Falschdarstellungen aufzuführen, die Service in einem einzigen Buch untergebracht hat. Seine Erzählung ist derart tief von Unaufrichtigkeit durchdrungen, dass Service wie unter Zwang historische Dokumente auch dann falsch darstellt, wenn gar kein Anlass dazu besteht.
Auf ein solches Beispiel stieß ich, als ich bei der Vorbereitung meines heutigen Beitrags die Biografie von Service noch einmal durchsah. Ich wählte ein beliebiges Kapitel aus, denn ich wusste: Egal, welche Seite ich aufschlug, mindestens ein faktischer Fehler würde sich finden. Also nahm ich mir Kapitel 14 vor, das mit „Krieg dem Kriege“ überschrieben ist. Es behandelt die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auf das Leben Leo Trotzkis. Auf S. 178 schildert Service, wie Trotzki auf einer Straße in Zürich dem deutschen Sozialdemokraten Hermann Molkenbuhr begegnete, der ein baldiges Ende des Kriegs voraussagte. Service zitiert die Worte Molkenbuhrs und fügt sogleich hinzu: „Molkenbuhr betrachtete Trotzkis apokalyptische Prognose als das Geschimpfe eines ‚Utopisten‘.“ (3) Die Szene ist in Gänze Trotzkis Autobiografie „Mein Leben“ entnommen, auf die Service in einer Fußnote verweist.
Wenn wir die angegebene Textstelle aufschlagen, stellen wir fest, dass es Service immerhin gelungen ist, Molkenbuhrs Worte so wiederzugeben, wie sie Trotzki im Gedächtnis geblieben waren. Mit dem Nachfolgenden allerdings – „Molkenbuhr betrachtete Trotzkis apokalyptische Prognose als das Geschimpfe eines ‚Utopisten‘“ – ändert er Trotzkis Darstellung erheblich ab. Nirgendwo behauptet Trotzki, dass Molkenbuhr „Trotzkis apokalyptische Prognose als das Geschimpfe eines ‚Utopisten‘“ betrachtete. Er berichtet etwas ganz anderes. Im Anschluss an das Molkenbuhr-Zitat schreibt Trotzki:
Molkenbuhr sprach selbstverständlich nicht seine persönliche Meinung aus. Das war einfach die offizielle Ansicht der Sozialdemokratie. Zur gleichen Zeit ging der französische Gesandte in Petersburg mit Buchanan eine Wette um fünf Pfund Sterling ein, dass der Krieg bis zu Weihnachten beendet sein würde. Da haben wir ‚Utopisten‘ doch so manches besser vorausgesehen als diese ‚realpolitischen‘ Herrschaften – von der Sozialdemokratie und von der Diplomatie. (4) [Hervorhebung hinzugefügt]
Services Darstellung lässt vor dem inneren Auge des Lesers ein Bild entstehen, das stark von der tatsächlichen Schilderung Trotzkis abweicht. Er stellt dem Leser eine imaginäre Szene vor, in der ein gealterter Sozialdemokrat einen „schimpfenden“ Trotzki vor sich hat, der apokalyptische Sprüche klopft. Trotzki wird zur politischen Karikatur herabgewürdigt. Im ursprünglichen Text hingegen äußert sich Trotzki nicht über seine unmittelbare Antwort auf Molkenbuhr. Er erinnert vielmehr in ironischem Ton an die völlig verfehlten politischen Annahmen der Opportunisten und Diplomaten. Wer, fragt er den Leser, waren denn nun die „Utopisten“? Die Revolutionäre, die die katastrophalen Folgen des Krieges vorhersahen, oder die sogenannten „Realpolitiker“, die davon ausgingen, dass in wenigen Monaten wieder normale Verhältnisse herrschen würden? Service verdreht nicht nur die historische Begebenheit. Er hat die politische Aussage des gesamten Absatzes nicht erfasst.
Nur einige Absätze weiter unten schreibt Service: „Zum ersten Mal in seinem Leben geriet er [Trotzki] in Streit mit Plechanow, den er jetzt mit äußerster Geringschätzung behandelte.“ (5) Im englischen Original benutzt Service einen noch härteren Ausdruck. Dort heißt es „with utter contempt“, also „mit völliger Verachtung“. Dieser Satz ist mit einer Fußnote versehen. Service lässt uns wissen, dass er aus einem Brief Trotzkis an den weitaus älteren Revolutionär Pawel B. Axelrod vom 22. Dezember 1914 zitiert. Dieser Brief findet sich in der berühmten Nikolajewski-Sammlung, die in der Hoover Institution der Stanford University im kalifornischen Palo Alto untergebracht ist und die Service als nahezu ausschließliche Recherchequelle für seine Biografie diente.
Als ich diesen Satz zum ersten Mal las, war ich bestürzt. Gewiss bedauerte Trotzki, dass Plechanow den Krieg unterstützte, doch die Behauptung, er habe den „Vater des russischen Marxismus“ mit „äußerster Geringschätzung“ („with utter contempt“) behandelt, verwunderte mich. Denn nachdem die Bolschewiki an die Macht gekommen waren, hatte Trotzki in mehreren bewegenden Aufsätzen seine tiefe und bleibende Bewunderung für Plechanow bekundet. Was also hatte Trotzki im Dezember 1914 in Wirklichkeit an Axelrod geschrieben? Hatte er in einem persönlichen Brief an einen älteren Genossen einer inneren Wut auf Plechanows politischen Verrat freien Lauf gelassen?
Trotzkis Brief an Axelrod besteht aus drei kurzen Absätzen. Nur der erste nimmt Bezug auf Plechanow. Er lautet:
Hast du Plechanows Broschüre gelesen? Ich habe angefangen eine Artikelserie darüber zu schreiben. Zum ersten Mal in meinem Leben polemisiere ich gegen Plechanow. Er ist nicht so fest, wie er mir erschienen war. (6)
Da den meisten Lesern die Quellen nicht zugänglich sind, dürften sie davon ausgehen, dass Service den Inhalt des von ihm zitierten Briefs richtig interpretiert. Ein solches Vertrauen in Service ist allerdings fehl am Platze. Nichts in besagtem Absatz deutet drauf hin, dass Trotzkis Haltung gegenüber Plechanow nunmehr von „äußerster Geringschätzung“ geprägt war. Diese Haltung, die auch Trotzkis Charakter in einem anderen Licht erscheinen lässt, hat Service frei erfunden. In Wirklichkeit bringt dieser kurze Brief Bedauern und Sorge über Plechanows Werdegang zum Ausdruck – Regungen, die in Anbetracht der damaligen Umstände weitaus mehr Sympathien erwecken, als die von Service nahe gelegte Verachtung.
Nur zwei Seiten weiter schreibt Service, nachdem er die Ankunft Trotzkis in Paris im Frühjahr 1915 aufgeführt hat:
Sowohl Trotzki als auch seine Frau sollten behaupten, sie hätten in Paris genügsam gelebt. Dafür gibt es keinen Beweis. Im Jahr 1914 schickte er der Kiewskaja Mysl sechs umfangreiche Artikel, die einen solchen Anklang fanden, daß die Zeitung ihn auch in den Jahren 1915/16 immer wieder beauftragte. Da die Franzosen und Russen Kriegsverbündete waren, konnte er sich darauf verlassen, daß das Geld rasch auf seinem Bankkonto in Paris landete. Den Trotzkis ging es in Frankreich während des Krieges nicht schlecht. (7)
Service legt nahe, dass Trotzki und seine Frau Natalja Sedowa über ihre Lebensverhältnisse in Paris gelogen hätten. Es gebe „keinen Beweis“ dafür, schreibt er kategorisch, dass das Paar in Paris genügsam gelebt habe. Aber wie haben sie denn gelebt? Im Überfluss? Konnten sie sich das behagliche Leben der wohlhabenden Mittelklasse leisten? Die einzigen Informationen, die Service über Trotzkis private Mittel anführt, sind 1) dass er 1914 sechs Artikel für die liberale Kiewskaja Mysl schrieb und 2) dass Trotzki 1915–1916 immer noch für diese Zeitung arbeitete. Über Trotzkis Honorare macht er keine genauen Angaben. Stattdessen behauptet Service ohne jegliche Belege, Trotzki habe sich darauf verlassen können, „daß das Geld rasch auf seinem Bankkonto in Paris landete“. Auf welche Tatsachen stützt sich diese Aussage?
Unglücklicherweise für Service werden die Behauptungen über Trotzkis Wohlstand und sprudelnde Geldquellen, die er im Brustton der Überzeugung vorbringt, von einem Brief widerlegt, auf den er in einer Fußnote nur eine Seite davor verweist. Am 11. Dezember 1915 schrieb Trotzki an Axelrod:
Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Am 20. muss Nat. Iv. Trotzkaja eine hohe Rechnung der Druckerei begleichen. Irgendwo im Konsulat liegen 200 Rubel für uns, die einfach nicht zu finden sind. Ich habe die „Kiewskaja Mysl“ in einem Brief gebeten, das Geld telegrafisch anzuweisen. Allerdings befürchte ich, dass es nicht rechtzeitig eintrifft. Könnte sie vielleicht mit deiner Hilfe einen Kredit bekommen – für höchstens 10–12 Tage? Das würde ihr helfen Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Wo ist Martow: Noch in Zürich oder schon abgereist? (8)
In diesem Brief bittet Trotzki Axelrod, ihm Geld zu leihen. Seine Frau schuldet der Druckerei einen größeren Betrag. Offenbar finanzieren sie politische Arbeit aus ihrem privaten Einkommen. Im Gegensatz zu Services Behauptungen sind Geldtransfers von Russland nach Frankreich nicht problemlos möglich. Die 200 Rubel, die Trotzki und seine Frau dringend brauchen, um „Unannehmlichkeiten zu vermeiden“, sind im Konsulat verloren gegangen. Wieder hat Service wichtige Informationen aus den Archiven falsch dargestellt und seinen Lesern vorenthalten, weil sie seiner unaufrichtig konstruierten und tendenziösen Erzählung widersprechen.
Gibt es gesicherte Erkenntnisse über die Bedingungen, unter denen Trotzki und seine Frau während ihres zehnjährigen politischen Exils in Westeuropa leben mussten, nachdem Trotzki 1907 eine waghalsige Flucht aus Sibirien gelungen war? Trotzki selbst schildert seine Lebensumstände in Wien, wo er sieben Jahre (1907–1914) verbrachte, in folgenden knappen Sätzen:
Mein Einkommen aus der Kiewskaja Mysl hätte für unsere bescheidene Existenz hingereicht. Aber es gab Monate, wo die Arbeit an der Prawda mir keine Möglichkeit ließ, auch nur eine bezahlte Zeile zu schreiben. Dann trat eine Krise ein. Meine Frau kannte den Weg ins Leihhaus gut, und ich habe wiederholt meine in üppigeren Tagen erworbenen Bücher zu den Antiquaren getragen. Es kam vor, dass unsere bescheidene Wohnungseinrichtung rückständiger Miete wegen gepfändet wurde. Wir hatten zwei kleine Kinder und keine Kinderfrau. Die Schwere des Lebens lastete doppelt auf meiner Frau. Aber sie fand dennoch Zeit und Kraft, mir bei meiner revolutionären Arbeit zu helfen. (9)
Bestätigt wird Trotzkis Schilderung durch die Erinnerungen des russischen Revolutionäres Moisseje Olgin, der in einem Vorwort zu einer frühen Ausgabe von Trotzkis Schriften auch dessen Leben im Exil beschrieb:
In Wien bewohnte er das Haus eines armen Mannes, ärmlicher als das eines normalen amerikanischen Arbeiters, der 18 Dollar die Woche verdient. Trotzki war sein Leben lang arm. In seiner Dreizimmerwohnung in einem Arbeitervorort von Wien standen weniger Möbel, als es zur Bequemlichkeit nötig gewesen wäre. Seine Kleider waren zu billig, um ihn in den Augen eines Wiener Kleinbürgers „anständig“ erscheinen zu lassen. Als ich ihn besuchte, traf ich Frau Trotzki bei der Hausarbeit an, wobei ihr die beiden hübschen blonden Jungen nicht wenig halfen. Das einzige, das die Wohnung aufhellte, waren die Bücher in jeder Ecke und womöglich große, aber verborgene Hoffnungen. (10)
Diese Beispiele für Geschichtsfälschungen finden sich auf nur vier Seiten, die ich beliebig aus Services Biografie herausgegriffen habe. Ohne Schwierigkeiten könnte ich Dutzende weitere finden. Einige dieser Fehler mögen, für sich genommen, relativ geringfügig erscheinen. In ihrer Gesamtwirkung erzeugen die auf 500 Seiten verteilten Fehler jedoch ein monströses Zerrbild der wirklichen historischen Persönlichkeit. Dem Leser wird ein „Trotzki“ vorgesetzt, der den Vorgaben eines heutigen Antikommunisten entspricht.
Der Historiker Ulrich Schmid, der Services Buch lobt, macht in einer Besprechung für die Neue Zürcher Zeitung geltend, dass die faktischen Fehler lediglich geringfügige Details beträfen. Er spricht von „Monita“, die den Gesamtwert des Buches nur unerheblich beeinträchtigten. Zur Rechtfertigung dieser Einschätzung führt er an: „Weder North noch Patenaude haben Argumente vorbringen können, die Service’ grundsätzliche Kritik an Trotzkis revolutionärem Fanatismus und seiner Gewaltbereitschaft entkräften. Trotzki setzte den Roten Terror in Jahr 1918 mit eiserner Faust um, organisierte die ersten Konzentrationslager und liess den Aufstand der Kronstädter Matrosen 1921 blutig niederschlagen.“ (11)
Schmid spricht nicht als Historiker, sondern als kleinbürgerlicher Moralprediger. Seine Position läuft darauf hinaus, dass die faktischen Fehler, die Service nachzuweisen sind, die Verurteilung Trotzkis aus ethischen Gründen nicht entkräften. Zu dieser Argumentation ist zu sagen: Service hätte einfach ein Pamphlet mit dem Titel „Weshalb ich Trotzki hasse“ verfassen sollen. Er hätte es nicht als historische Biografie auf den Markt bringen sollen, sondern als Erklärung seiner eigenen ethischen, politischen und womöglich auch religiösen Überzeugungen. Ulrich Schmid versäumt zu erklären, weshalb Trotzkis Unterstützung für den Roten Terror im Jahr 1918 (der einsetzte, nachdem führende Bolschewiki ermordet worden waren und ein Anschlag auf Lenins Leben nur knapp gescheitert war) und die Niederschlagung des Kronstädter Aufstands Service der Verantwortung enthebt, die geschichtlichen Ereignisse mit Sorgfalt zu behandeln und sich zu bemühen, die historischen Umstände und die politischen Zwänge zu erfassen, die das Handeln Trotzkis und der bolschewistischen Regierung bestimmten.
Kein ernsthafter Historiker verhält sich gleichgültig gegenüber Fragen der Moral. Aber eine moralische Verurteilung ist nur dann überzeugend, wenn sie sich zwingend aus der Logik der Erzählung selbst ergibt. Ein Historiker sollte sich nicht veranlasst sehen, Dokumente und Ereignisse zu vertuschen oder zu verfälschen, um seinen „moralischen“ Standpunkt zu begründen.
Ian Kershaw beispielsweise, ein wahrhafter Historiker, hat es nicht nötig, Hitler gegenüber mahnend den Finger zu erheben und seine Leser immer wieder daran zu erinnern, wie furchtbar er war. Hitlers Verbrechertum und der Schrecken seiner Herrschaft ergeben sich aus der Erzählung des Historikers. Niemals kommen Zweifel daran auf, dass Kershaw das Archivmaterial kennt und umfassend mit der Sekundärliteratur vertraut ist. Außerdem gilt Kershaws Interesse als Historiker nicht einfach Hitler als Einzelperson. Er bemüht sich zu verstehen und zu erklären, wie ein solcher Mann an die Macht gelangen und zum Objekt der Massenverehrung werden konnte.
Natürlich wird die Frage der Moral durch Kershaws Themenwahl vereinfacht. Eine ehrliche und gewissenhafte Behandlung der historischen Dokumente und Ereignisse führt unweigerlich zu der Schlussfolgerung, dass Hitler an der Spitze eines verbrecherischen Regimes stand. Wer diese Herrschaft zu rechtfertigen sucht, wie der berüchtigte David Irving, muss zu Verdrehungen, Fälschungen und Lügen Zuflucht nehmen.
Genau hier liegen die Probleme von Service begründet. Er konnte den historischen Dokumenten nicht den Stoff entnehmen, den er brauchte, um Trotzki als nichtswürdigen, ja sogar kriminellen Politiker darzustellen. Daher konnte er sein Ziel, genau wie in den 1930er-Jahren Stalin, nur mit Fabrikationen, Halbwahrheiten und offenen Lügen erreichen.
In einem Moment der Ehrlichkeit äußerte Service die Hoffnung, dass ihm gelungen sei, was der Mörder nicht erreichen konnte: Trotzkis Ruf zu zerstören. Doch damit ist er auf der ganzen Linie gescheitert. Das einzige, das durch die Biografie von Service restlos zerstört wurde, ist der Ruf ihres Autors.
Quellen
1) http://de.wikipedia.org/wiki/Habent_sua_fata_libelli
2) E. H. Carr, What is History? (London: Penguin, 1990), S. 23.
3) Robert Service, Trotzki – Eine Biografie (Suhrkamp 2012), S. 178.
4) Leo Trotzki, Mein Leben (Berlin 1990), S. 215.
5) Service, S. 179.
6) Nach der Übersetzung ins Englische von Fred S. Choate
7) Service, S. 182.
8) Nach der Übersetzung ins Englische von Fred S. Choate
9) Leo Trotzki, Mein Leben (Berlin 1990), S. 210
10) http://www.marxists.org/archive/trotsky/1918/ourrevo/ch01.htm
11) Ulrich M. Schmid, „Streit um Trotzki“, Neue Zürcher Zeitung 21. Februar 2012, S. 42