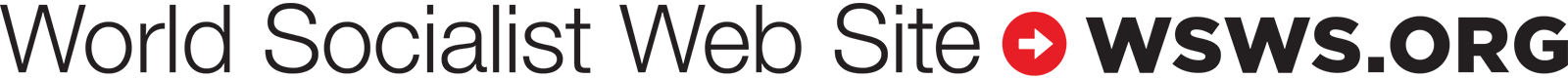Die Einführung neuer Zölle, die US-Präsident Donald Trump am Mittwoch angekündigt hat, stellt eine wirtschaftliche Kriegserklärung an den Rest der Welt dar.
Mit seinem Vorhaben verfolgt Trump zwei Ziele, die miteinander verbunden sind. Wirtschaftlich versucht er, durch höhere Zölle Hunderte Milliarden Dollar einzunehmen, um die immer schlechtere wirtschaftliche und finanzielle Lage der USA zu verbessern und gleichzeitig weltweit ihre wirtschaftlichen Rivalen, vor allem China, zu schwächen. Die Kosten dafür werden letztlich US-Unternehmen und Verbraucher zahlen.
Daneben will er auch die militärischen Kapazitäten der USA stärken. Durch die Zölle sollen ausländische und amerikanische Unternehmen gezwungen werden, ihre Tätigkeiten auf amerikanischem Boden auszuweiten, wobei ein Großteil davon der Ausstattung des Militärs dient.
Nach den neuen Regelungen werden die USA „reziproke Zölle“ gegen zahlreiche Länder verhängen. Die neuen US-Zölle entsprechen jedoch nicht den Zöllen, die von diesen Ländern auf Importe aus den USA erhoben werden.
Vielmehr wurde jedem der betroffenen Länder ein Zahlenwert zugeteilt. In diesen Wert flossen nicht nur der Zoll auf US-Importe ein, sondern alle Maßnahmen, die nach dem Ermessen der USA die gleichen nachteiligen Auswirkungen haben wie ein Zoll. Dazu gehören u.a. Subventionen, regulatorische Auflagen, biologische Vorschriften für Agrarprodukte und der Wert der Landeswährung.
Der reziproke Zoll wurde auf die Hälfte dieses Zahlenwerts festgelegt. Für China, ein Hauptziel der neuen Regelung, haben die US-Wirtschaftsvertreter eine Zahl von 67 festgelegt, und der reziproke Zoll beträgt somit 34 Prozent. Dazu kommen noch die 20 Prozent, die bereits zuvor für chinesische Güter eingeführt worden waren, womit die Gesamthöhe auf 54 Prozent steigt.
Eine der unmittelbaren Auswirkungen der Zollerhöhungen, die am 9. April in Kraft treten sollen, wird eine deutliche Preiserhöhung für amerikanische Verbraucher bei zahlreichen in China hergestellten Produkten sein.
Der Europäischen Union, von der Trump behauptet hat, sie sei gegründet worden, um die USA „über den Tisch zu ziehen“, wurde die Zahl 39 zugeordnet und der zusätzliche Zoll wird bei 20 Prozent liegen.
Die Länder Südostasiens, von denen mehrere zu Produktionszentren für viele Unternehmen geworden sind, die die Auswirkungen von Handelsverboten gegen China umgehen wollen, werden noch schwerer getroffen werden. Für Thailand wurde ein Zoll von 36 Prozent festgelegt, für Malaysia 24 Prozent, für Vietnam 46 Prozent.
Der Zoll für Südkorea, das bereits von dem um Mitternacht in Kraft getretenen 25-prozentigen Zoll auf „im Ausland hergestellte“ Autos betroffen ist, wird ebenfalls 25 Prozent betragen. Und die Liste ließe sich noch weiter fortsetzen.
Für alle Länder, für die kein „reziproker Zoll“ anfällt, werden dennoch zehn Prozent zusätzlich auf ihre Exporte erhoben. Diese Maßnahme soll u.a. verhindern, dass Länder einen Teil ihrer Tätigkeiten in Länder verlegen, die nicht ausdrücklich im Visier der USA sind. Jetzt können sie sich nirgendwo hin flüchten.
Bevor Trump die neuen Zölle im Rosengarten des Weißen Hauses vorstellte, ließ er zu Beginn seiner Rede die mittlerweile übliche Schimpftirade gegen den Rest der Welt vom Stapel:
„Unser Land wurde jahrzehntelang von nahen und fernen Ländern geplündert, beraubt, geschändet und bestohlen, von Freunden ebenso wie von Feinden.“ Später erklärte er, in einigen Fällen seien die Freunde schlimmer gewesen alsdie Feinde.
„Fleißige amerikanische Bürger mussten jahrelang untätig zusehen, wie andere Nationen reich und mächtig wurden, größtenteils auf unsere Kosten. Jetzt sind wir an der Reihe, aufzublühen.“
Doch Trumps wiederholte Behauptung, die Zölle würden den USA ein neues goldenes Zeitalter bescheren, sind Unsinn. Sie werden die Inflation nicht verringern, sondern die Preise für eine breite Palette von Waren erhöhen. Durch die Autozölle werden die Preise für Autos um zwischen 3.000 und 10.000 Dollar ansteigen.
Tausende von Arbeitsplätzen werden verloren gehen, und alle neuen Werke in den USA werden aus Kostengründen in hohem Maße automatisiert sein und nur über eine kleine Belegschaft verfügen.
Zudem ist der Begriff „American-made“ bedeutungslos. Jedes Auto auf der Welt, auch in den USA, ist das Ergebnis einer komplexen internationalen Arbeitsteilung. So besteht der Ford-Pickup F-150, eines der Aushängeschilder dafür, was als „amerikanisches Auto“ gilt, aus Tausenden von Teilen, die aus der ganzen Welt importiert sind.
Trump stellt die neuen Zölle als Wunderheilmittel dar, mit dem sich gleichzeitig die Staatsschulden der USA abbezahlen und das Außenhandelsdefizit verringern ließen.
Doch laut Schätzungen der Finanzgesellschaft Capital Economics werden sich die Einnahmen durch die Zölle auf höchstens 800 Milliarden Dollar belaufen.
Gleichzeitig liegen die Zinsen für US-Staatsschulden mittlerweile bei 36 Billionen Dollar und steigen jedes Jahr um eine Billion, womit sie zum größten Posten im Staatshaushalt werden.
Die Handelspolitik der Trump-Regierung ist voller innerer Widersprüche. Einerseits will sie durch eine Schwächung des Dollar-Kurses, durch die amerikanische Waren auf dem Weltmarkt billiger würden, die Exportmärkte ausweiten. Doch der Status des Dollar als internationale Reservewährung, den Trump als existenzielle Frage für die USA betrachtet und dessen Verlust er mit einer Kriegsniederlage gleichgesetzt hat, erfordert einen starken Dollar.
Zudem ist die US-Wirtschaft – so sehr Trump auch das Zollregime von Präsident William McKinley vom Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts beschwört – seit langem über ihre nationalen Grenzen hinausgewachsen und abhängig von einer expandierenden Weltwirtschaft.
Doch steht der Weltwirtschaft, die bereits teilweise die niedrigsten Wachstumsraten seit Jahrzehnten verzeichnet, jetzt noch ein weiterer schwerer Schlag bevor. Die Financial Times veröffentlichte Anfang der Woche Berechnungen, laut denen Vergeltungsmaßnahmen, die fast sicher erfolgen werden, Kosten von bis zu 1,4 Billionen Dollar verursachen könnten.
Außerdem herrscht auf den Finanzmärkten zunehmend Nervosität, da sie sich wegen der steigenden Schulden von Staaten und Unternehmen bereits in fragilem Zustand befinden.
Dies kam in einem Brief zum Ausdruck, den Larry Fink, der Vorstandsvorsitzende von BlackRock, der größten Vermögensverwaltungsgesellschaft der Welt, diese Woche an die Aktionäre richtete. Er sagte, dass „der Protektionismus mit voller Wucht zurückgekehrt ist“ und dass die Menschen mit denen er spreche „sich größere Sorgen um die Wirtschaft machen als jemals zuvor in der jüngsten Vergangenheit“.
Zur „jüngsten Vergangenheit“ gehört auch die globale Finanzkrise 2008 und die Finanzkrise vom März 2020, in welcher der US-Anleihenmarkt eingefroren war.
Trump verhängt die weitreichenden Zölle auf der Grundlage des International Emergency Economic Powers Act von 1977, der unter der demokratischen Carter-Regierung verabschiedet wurde. Dieses Gesetz ermächtigt ihn, einen nationalen Notstand auszurufen, wenn „ungewöhnliche und außergewöhnliche“ Bedrohungen von außerhalb der USA die nationale Sicherheit, Außenpolitik oder Wirtschaft gefährden.
Im so genannten Faktenblatt des Weißen Hauses hieß es, der nationale Notstand gehe auf das hohe und langanhaltende Außenhandelsdefizit zurück. Im Jahr 2024 betrug es 918 Milliarden Dollar und damit 17% mehr als im Vorjahr.
Das Weiße Haus machte in seiner Stellungnahme deutlich, dass militärische Erwägungen eine zentrale Rolle bei den neuen Zöllen spielen. Die „reziproken Zölle“ richten sich gegen eben die Länder, „mit denen die USA das größte Außenhandelsdefizit“ haben, wobei wirtschaftliche Fragen in dem Dokument durchgängig mit militärischen verbunden werden.
„Gefährliche“ wirtschaftspolitische Maßnahmen und Praktiken von Handelspartnern hätten die Fähigkeit der USA untergraben, Waren für den öffentlichen und militärischen Bereich zu produzieren, und gefährdeten damit die nationale Sicherheit.
„Made in America“ sei nicht nur ein Schlagwort, sondern „eine Priorität dieser Regierung für die Bereiche Wirtschaft und nationale Sicherheit.“
Die US-Lagerbestände an militärischen Gütern seien „zu gering, um mit den nationalen Verteidigungsinteressen vereinbar zu sein“; Entwicklungen bei Biotechnologien, Batterien und Mikroelektronik seien notwendig, um „die Bedürfnisse der Verteidigungspolitik zu stärken.“
Zur Erläuterung des Schwerpunkts auf andere Handelshemmnisse als Zölle, insbesondere in Bezug auf China, heißt es, dass diese nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit der USA untergrüben, sondern auch „die wirtschaftliche und nationale Sicherheit der USA bedrohten, indem sie unsere Abhängigkeit von ausländisch kontrollierten Lieferketten für kritische Industriezweige sowie für Güter des täglichen Bedarfs erhöhen“.
Das Faktenblatt schilderte den zentralen Kern des Wirtschaftskrieges:
„Die heutige IEPPA [International Emergency Economic Powers Act] Verordnung beinhaltet auch die Befugnis zu Änderungen, sodass Präsident Trump den Zoll erhöhen oder senken kann, wenn sich die Handelspartner wehren oder wenn die Handelspartner nennenswerte Schritte zur Besserung nicht-reziproker Handelsabkommen unternehmen und sich in Fragen der Wirtschaft und der nationalen Sicherheit an die Seite der USA stellen.“
Mit anderen Worten, wer aus der Reihe tanzt, wird getroffen – und wenn er sich wehrt, noch härter.
Die Zollmaßnahmen sind nicht nur, aber sicherlich auch eine Kriegsvorbereitung, und in früheren Zeiten hätten sie sogar als Kriegshandlung betrachtet werden können. Heute sind die Grenzen zwischen Krieg und Frieden fließend, da der Krieg an der wirtschaftlichen Front direkt mit dem expansionistischen Kurs des US-Imperialismus in Zusammenhang steht – wie die Drohung, Kanada zum 51. US-Bundesstaat zu machen, die anhaltenden Bestrebungen zur Übernahme Grönlands und die verstärkten Luftangriffe auf die Huthi im Jemen, um nur einige zu nennen.